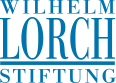Was beim Kauf im Kopf passiert

"Messung, Determinanten und Entstehung von Markenemotionen"
Marke werden - diese Strategie verfolgen viele Unternehmen, nicht nur Firmen der Textil- und Bekleidungsbranche. Denn je stärker eine Marke ist, umso eher wird sich ein Konsument, der heute aus einer Vielzahl unterschiedlicher Produkte und Leistungen wählen kann, für sie entscheiden. Ausgehend von dieser These investieren Industrie und Handel Jahr für Jahr immer mehr Geld, um ihre Produkte und Leistungen zu Marken aufzubauen oder deren Strahlkraft zu erhalten. Etwa 56.000 Marken gibt es heute alleine in Deutschland, mehr als doppelt so viel wie noch vor dreißig Jahren, hat die FAZ im vergangenen Jahr in einem Artikel vorgerechnet. Und der Aufwand Marken zu etablieren oder zu revitalisieren, habe sich "ebenfalls verdoppelt - auf annähernd 17 Milliarden Euro". Ob sich diese Investitionen lohnen entscheidet letztendlich der Käufer. Wenn er in Bruchteilen einer Sekunde eine Kaufentscheidung trifft. Um diesen winzigen, aber für Anbieter enorm wichtigen Moment geht es im Forschungsvorhaben von Hilke Plaßmann, das in diesem Jahr die Projektförderung der Wilhelm-Lorch-Stiftung erhält. Die junge Betriebswirtschaftlerin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Handelsmanagement und Netzwerkmarketing sowie am Marketinginstitut für Textilwirtschaft an der Universität Münster bei Prof. Dr. D. Ahlert. Im Team mit Kollegen aus unterschiedlichen Disziplinen forscht sie auf dem noch relativ neuen Gebiet der Neuroökonomie, die ökonomische Entscheidungen und die Funktionsweise des menschlichen Gehirns in Zusammenhang setzt. Bisher gingen ökonomische Theorien davon aus, dass Konsumenten weitgehend autonom und rational entscheiden. Das Münsteraner Forscherteam, dem neben Hilke Plaßmann und Dr. Peter Kenning auch Neurologen und Radiologen angehören, hat jedoch herausgefunden, dass vor allem der Kauf starker Marken nicht vernunftgesteuert abläuft. Für ihre Untersuchungen bedienten sich die Forscher eines hochmodernen Kernspintomographen und beobachteten die Abläufe im Gehirn, während den Probanden unterschiedliche Marken - unter anderem das Logo von H&M, C&A und P&C - präsentiert wurden. "Die ersten Ergebnisse waren erstaunlich. Es konnte festgestellt werden, dass eine subjektiv starke Marke zu einer Verringerung der Hirnaktivität in Hirnarealen führt, die für rationale Entscheidungen zuständig sind, und zu einer vermehrten Aktivität in Arealen, die für emotionale Entscheidungen zuständig sind", erklärt Hilke Plaßmann.
Mit ihrem Projekt will sie diesen Markeneffekt der so genannten "kortikalen Entlastung" nun genauer untersuchen und herausfinden, inwieweit unbekannte Logos gezielt "emotional aufgeladen" werden können. Gelingt dies, hofft Plaßmann aus ihrer Grundlagenforschung die Markentheorie derart erweitern zu können, dass daraus Schlüsse für das Management abgeleitet werden können. Hilke Plaßmann plant, ihre Arbeit bis zum Januar 2005 zu beenden und möchte im nächsten Jahr ihre Promotion abschließen. Dann will die 27-jährige weiter wissenschaftlich arbeiten und "anwendungsbezogene Grundlagenforschung" betreiben, die den Unternehmen nützt: "Es gibt im Marketing noch sehr viele unbeantwortete Fragen."
-bm-